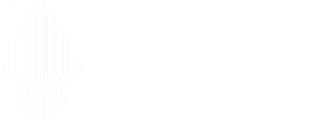- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- Magadino (San Carlo Borromeo)
- Mannheim (Jesuitenkirche)
- Mannheim (Jesuitenkirche, Chororgel)
- Maria Feicht (Wallfahrtskirche)
- Maria Luggau (Wallfahrtskirche)
- Maria Rain (Wallfahrtskirche)
- Marienstatt (Abteikirche)
- Markdorf (St. Nikolaus)
- Meggen (St. Bartholomäus)
- Mellweg (St. Gertraud)
- Minden (Martinikirche)
- Mudersbach (Maria Himmelfahrt)
- Mudersbach (ehem. Hausorgel Hiller)
- Mühlen (St. Bonaventura)
- München (Deutsches Museum, Steinmeyer)
- München (Deutsches Museum, Ahrend)
- Münster (St. Lamberti)
- Münster (Petrikirche)
- Münster (Erlöserkirche)
- Müsen (ev. Kirche)
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Minden
Ev.-luth. Stadt- und Ratskirche St. Martini
Orgel: Gustav Steinmann (Vlotho), 1964–66, unter Verwendung von historischen Registern.
Gehäuse: Rückpositiv 1591, Hauptwerk teilw. Johann Joseph Mencke 1749.

Die Martinikirche in der Stadtmitte von Minden wurde zusammen mit einem Kollegiatstift kurz vor 1029 gegründet. Die Weihe der fertiggestellten Kirche erfolgte vermutlich erst nach 1055. Erst rund hundert Jahre später erhielt die Kirche 1142 einen Turm. Der heute älteste Teil der Kirche entstand nach zwei Bränden um 1261/62. Im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts wurde der einjochige Chor errichtet und im 14. Jahrhundert das Langhaus zur gotischen Hallenkirche umgestaltet. In dieser Form präsentiert sich die Kirche bis heute.
1530 wurde die Kirche im Zuge der Reformation evangelisch-lutherisch – sie erhielt eine der ersten evangelischen Kirchenordnungen Westfalens. Während das Martinistift katholisch blieb, in der Kirche blieben den Kanonikern jedoch nur noch noch Chor, Sakristei, Kapitelstube und Kreuzgang, während das Kirchenschiff von der nun lutherischen Gemeinde genutzt wurde.
Bereits 1530 muss eine Orgel in der Martinikirche vorhanden gewesen sein, auf die der Reformator Nikolaus Krage in seiner Kirchenordnung hinweist.
Wenige Jahrzehnte später ist der Bau einer neuen Orgel in der Martinikirche nachgewiesen, dessen Gehäuse bis heute als Rückpositiv erhalten ist und damit als eines der ältesten Orgeldenkmäler Westfalens gilt. Im Jahr 1591 beurkundeten die Diakone von St. Martini, dass sie „fünftzig thaler zu behueff des Orgelen und erbawunge derßälbige wohlempfangen“ hätten; wenig später wurden nochmals „anderthalff hundert Gangbahrer Reichsthaler“ zu diesem Zweck geliehen. Der Erbauer dieser Orgel ist unbekannt, während das Baujahr 1591 in das Schnitzwerk an der Unterseite des Gehäuses eingearbeitet ist (das Lagerbuch von 1892 gibt allerdings 1595 als Erbauungsjahr an). Aufgrund der Art der Holzschnitzarbeiten geht man bei dem Orgelbauer von einem Meister der niederländischen Schule aus, etwa Jürgen Slegel oder Meister Joist, die beide in dieser Zeit auch in Westfalen tätig waren.
1677 wurde die Orgel renoviert, wobei nichts Genaueres über den Umfang der Arbeiten dokumentiert ist. 1703 trug die Orgel starke Schäden davon, als bei einem Sturm ein Teil des Kirchturms einstürzte. Über eine Wiederherstellung, die wohl stattgefunden haben muss, geben die Akten keine Auskunft; es ist aber denkbar, dass Hinrich Klausing aus Herford die Renovierung übernahm, da er zur gleichen Zeit mit dem Bau einer neuen Orgel in der Mindener Mauritiuskirche beschäftigt war.
Ein größerer Umbau der Orgel erfolgte 1749 durch den Osnabrücker Orgelbauer Johann Joseph Mencke – vermutlich ausgeführt durch dessen Schüler Johann Adam Berner. Danach hatte die Orgel offenbar 32 Register auf drei Manualen (Rückpositiv, Hauptwerk, Brustwerk) und Pedal, wie aus einer Dispositionsaufzeichnung des Mindener Orgelbauers und Instrumentenmachers Franz Heinrich Koch von 1839 hervorgeht. 1793 führte der Mindener Orgelbauer Justus Henrich Wilhelm Müller eine Reparatur der Orgel durch; in diesem Zusammenhang ist in den Akten der Hinweis erhalten, dass die Orgel damals bereits gleichschwebend gestimmt war. 1801 wurde ein Wartungsvertrag mit Müller geschlossen.
Nachdem 1825 ein Blitzschlag die Orgel beschädigt hatte, plante man einen Neubau, der aber am Ende nicht zur Ausführung kam. Stattdessen führte der bereits genannte Franz Heinrich Koch 1840 für 60 Taler eine umfangreiche Reparatur des Instruments durch. Da der in Fachkreisen als „Orgelfuscher“ berüchtigte Koch jedoch nicht imstande war, eine sachgemäßge Stimmung und Intonation des Pfeifenwerks vorzunehmen, wurde dazu der Mindener Orgelbauer Ferdinand Friedrich Wilhelm Kummer beauftragt. Kummer baute sechs Jahre später (1846) auch zwei neue Register – Gemshorn 8' und Gambe 8' – ein.
Das Ende der Barockorgel war der Um- und technische Neubau durch die Fa. Furtwängler & Hammer aus Hannover im Jahr 1891. Die Orgel erhielt nun 50 Register, von denen noch 20 aus älteren Bauphasen stammten – sie standen auf pneumatischen Kegelladen und entsprachen in ihrem Klangbild ganz dem spätromantischen Klangideal der Zeit. Auch die architektonische Anlage des Instruments wurde komplett verändert: Das Hauptwerksgehäuse wurde um zwei Meter in den Kirchenraum vorgezogen und die Pedaltürme wurden entfernt. Das Gehäuse des Rückpositivs kam – in Berücksichtigung seines historischen Werts – als pfeifenloses Zierwerk in die Front des Hauptgehäuses.
Abgesehen von den Pfeifenablieferungen für die Rüstungsindustrie im Ersten Weltkrieg 1917 blieb die Orgel von Kriegsschäden weitgehend verschont. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs führte die Fa. Emil Hammer (Hammer) 1946 eine Überholung und Umdispotnierung im Sinne der Orgelbewegung durch.
In Verbindung mt dem Westfälischen Landesamt für Denkmalpflege und unter wissenschaftlicher Beratung durch Prof. Dr. Rudolf Reuter (Münster) und Prof. Dr. Arno Schönstedt (Herford) führte die Orgelbauwerkstatt Gustav Steinmann aus Vlotho in den Jahren 1964–66 eine Rückführung auf den barocken Bauzustand durch. Dabei handelt es sich quasi um einen technischen Neubau auf mechanischen Schleifladen, der unter Wiederverwendung der damals als historisch wertvoll anerkannten Substanz einen an die Dispositionsaufzeichnung von 1839 angelehnten Zustand anstrebte. Dabei wurde auch das Hauptwerksgehäuse nach historischem Vorbild rekonstruiert und das historische Rückpositiv von 1591 wieder in die Emporenbrüstung eingelassen. Das Pedalwerk fand nun hinter einen schlichten Holzverkleidung zu beiden Seiten hinter dem Hauptgehäuse seinen Platz.
Im Spätsommer 1990 erfolgte durch Orgelbaumeister Franz Rietzsch (Hiddestorf) eine Überarbeitung der Intonation und des Mixturaufbaus; außerdem wurde der Winddruck erhöht und eine ungleichstufige Stimmung nach Neidhardt gelegt. 2006 kamen zwei neue Pedalregister – Gedackt 8' und Oktave 4' hinzu. Die jüngste Reinigung und Generalüberholung übernahm Orgelbaumeister Mathias Johannmeier (Levern) in zwei Abschnitten 2023 und Ende 2024 bis Anfang 2025.
Das am norddeutschen Barockorgelbau des 17. Jahrhunderts orientierte Instrument umfasst heute 40 Register, unter denen sich in 13 Registern historisches Pfeifenmaterial befindet, das teilweise noch bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht.
I. RÜCKPOSITIV | C–g³
Prinzipal 8'
Gedackt 8' [1749]
Oktave 4'
Spitzflöte 4' [1891]
Nasat 2 2/3' [1749/1891/1966]
Rohrflöte 2' [1749/1946]
Terz 1 3/5'
Oktave 1'
Mixtur 5f. [1 1/3'] [1990 neu zus.]
Dulzian 16'
Krummhorn 8'
Tremulant
II. HAUPTWERK | C–g³
Prinzipal 16'
Quintade 16' [1591]
Oktave 8'
Rohrflöte 8' [1591/1749/1891]
Oktave 4'
Rohrflöte 4' [1749?]
Quinte 2 2/3'
Oktave 2'
Mixtur 5-6f. [2'] [1990 neu zus.]
Scharf 3f. [1'] [bis 1990 Zimbel 2/3']
Trompete 16'
Trompete 8'
RP/HW
BW/HW
III. BRUSTWERK | C–g³
Holzgedackt 8' [1891]
Gedackt 4'
Prinzipal 2'
Quinte 1 1/3'
Sesquialtera 2f.
Zimbel 3f. [1/2']
Regal 8'
Tremulant
PEDAL | C–f¹
Prinzipal 16'
Subbass 16' [19. Jh.]
Oktave 8' [vor 1749]
Gedakt 8' [2006]
Holzpfeife 4' [1891]
Oktave 4' [2006]
Gr. Mixtur 6f. [4'] [1891]
Posaune 16'
Trompete 8'
Trompete 4'
RP/Pedal
HW/Pedal
Alle nicht näher bezeichneten Register stammen von 1964/66.
Mechanische Schleiflade.
D-32423 Minden | Martinikirchhof
Quellen und Literatur: Rudolf Reuter, Orgeln in Westfalen, Kassel u. a. 1965, S. 193ff ⋄ 400 Jahre historische Orgel in der St. Martinikirche Minden, Minden 1991 ⋄ Eigener
Befund.
Nr. 451 | Diese Orgel habe ich am 03.11.2012 im Rahmen eines Meisterkurses gespielt.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 25.04.2025.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25