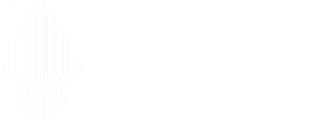- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- Lage (St. Johannes d. T.)
- Langenhorst (Stiftskirche)
- Leipzig (Thomaskirche, Bach-Orgel)
- Lemförde (Martin-Luther-Kirche)
- Lemförde (Zu den heiligen Engeln)
- Lemwerder (Hl. Geist)
- Letmathe (St. Kilian)
- Levern (Stiftskirche)
- Limburg (Dom)
- Littfeld (Hl. Geist)
- Lohre (ev. Kirche)
- Loikum (St. Antonius)
- Löningen (St. Vitus)
- Ludmannsdorf (St. Jakobus d. Ä.)
- Ludwigsburg (Friedenskirche)
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Limburg, Dom St. Georg
Orgel von Orgelbau Johannes Klais (Bonn), 1978.

Mit seinen sieben Türmen weithin sichtbar hoch über der Lahn gehört der Limburger Dom zu den bekanntesten Bauwerken Deutschlands – von 1964 bis 1992 zierte der Dom daher auch die Rückseite des
Tausendmarkscheins. Von 1206 bis 1235 wurde die vermutlich dritte Kirche an dieser Stelle erbaut, die bereits weitgehend der heutigen Gestalt der späteren Bischofskirche entsprach – in
großartiger Weise sind hier französische Frühgotik und rheinische Spätromanik in eigenständiger Formensprache vereint.
In der Kirche muss es auch schon recht früh eine Orgel gegeben haben, denn in den Urkunden ab 1331 wird vielfach das Orgelspiel erwähnt. Damit gehört das Limburger Instrument zu den frühesten
nachweisbaren Orgeln in Hessen. Spätestens ab der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hat es auch eine zweite, kleinere Orgel im der Kirche gegeben, die erstmals 1443 erwähnt wird. 1471 ist eine
größere Orgelreparatur eines Werks mit 13 Registern nachgewiesen. Ein größerer Umbau erfolgte 1581 durch Johannes Scholl, Bürger und Orgelmacher zu Köln. Ob und wie die Orgel bei den Verwüstungen
der Kirche im Dreißigjährigen Krieg Schaden genommen hatte, wissen wir nicht. Erst 1708 ist in den Akten wieder eine Renovierung durch den Wanderorgelbauer Elias Salvianer dokumentiert.
1749 begann eine umfassende Umgestaltung des Kirchenraums im Stil des Spätbarock. In diesem Zuge erhielt die Kirche auch eine neue Orgel: Das neue Werk des Frankfurter Orgelbauers Johann
Christian Köhler entstand in den Jahren 1750–52 und umfasste 36 Register auf drei Manualen und Pedal. Diese Orgel erfuhr im Zuge der historisierenden Renovierung des inzwischen zur Bischofskirche
erhobenen Doms in den Jahren 1871 bis 1873 durch die Orgelbauer Gebr. Keller eine neue Gestalt; neben einigen klanglichen Veränderungen wurde vor allem ein neues Gehäuse in neoromanischen Formen
gebaut, in das nun auch das ehemalige Rückpositiv integriert wurde.
Die umgebaute Köhler-Orgel hatte bis 1911 Bestand, als durch Johannes Klais (Bonn) ein neues Instrument (op. 841) mit 50 Registern in das neoromanische Gehäuse von 1871/73 eingefügt wurde. Im
Sommer 1912 fand die Einweihung der neuen Orgel in Limburg statt. Diese Orgel erfuhr im Rahmen einer Domsanierung 1935 einen Umbau durch die Erbauerwerkstatt und wurde dabei auf 54 Register
erweitert. Nun stand das Instrument aufgeteilt in den seitlichen Turmhallen, war daher vom Kirchenschiff aus nicht mehr sichtbar.
In den 1970er Jahren begann das umfassende Restaurierungprojekt des Dom-Innenraums, das sich in mehreren Bauphasen über fast 20 Jahre erstreckte. Im Zuge dieser Arbeiten erhielt der Dom auch eine
neue Orgel, die 1977/78 von Orgelbau Klais (Bonn) als Opus 1553 erbaut wurde. Die alte Klais-Orgel von 1911/35 kam in die St.-Pankratius-Kirche Oberhausen-Osterfeld, wo sie mit der dortigen
Breil-Orgel zu einem neuen Instrument vereint wurde.
Die am Pfingstfest 1978 eingeweihte, neue Klais-Orgel im Limburger Dom steht auf der Westempore und ist mit ihrem von Josef Schäfer (Fa. Klais) entworfenen, flügelartig weit ausgestreckten
Gehäuse, das nur auf sechs Rundstahlstützen ruht, ein markanter Blickfang in dem weiten Kirchenraum. Die Traktur wird hinter einer Glaswand vom Spieltisch aus in das Gehäuse geführt. Im
mittleren, zweigeschossigen Teil sind Positiv und Oberwerk untergebracht. Das Schwellwerk steht nicht sichtbar dahinter. Zu beiden Seiten sind in den Außenfeldern Hauptwerk und Pedalwerk (ganz
außen) aufgestellt. Die Disposition, in der die Register Wienerflöte 8' und Hohlflöte 4' im Hauptwerk noch aus der Orgel von 1912 stammen, versteht sich im besten Sinne als „Universalorgel“, auf
der sich alle Stile der Orgelmusikgeschichte adäquat interpretieren lassen.
2020 erfolgte eine grundlegende Revision des Instruments durch die Orgelmanufactur Vleugels (Hardheim). Neben einer Reinigung und klanglichen wie technischen Generalüberholung erhielt die Orgel auch ein neues Gebläse sowie eine moderne Setzeranlage (anstelle der nur acht Setzerkombinationen von 1978, davon vier für die Werke geteilt). Schließlich erfolgte eine sorgfältige Nachintonation durch Christian Heiden von Orgelbau Vleugels.
I. OBERWERK | C–a³
Praestant 8’
Holzgedackt 8’
Quintade 8’
Principal 4’
Rohrflöte 4’
Octave 2’
Larigot 1 1/3’
Sesquialter 2f. [2 2/3’]
Scharff 4f. [1’]
Cor anglais 16’
Cromorne 8’
Tremulant
Koppel III–I
Koppel IV–I
II. HAUPTWERK | C–a³
Praestant 16’
Principal 8’
Bifaria 8’
Wienerflöte 8’
Spitzgamba 8’
Octave 4’
Hohlflöte 4’
Quinte 2 2/3’
Superoctave 2’
Cornet 5f. [8’]
Mixtur 5f. [2’]
Cymbel 3f. [1/3’]
Trompete 8’
Koppel I–II
Koppel III–II
Koppel IV-II
III. SCHWELLWERK | C–a³
Rohrbordun 16’
Holzprincipal 8’
Trichtergedackt 8’
Salicional 8’
Vox coelestis 8’
Octavflöte 4’
Viola 4’
Waldflöte 2’
Fourniture 5f. [2 2/3’]
Basson 16’
Trompette 8’
Hautbois 8’
Clairon harm. 4’
Tremulant
Koppel IV–III
IV. SCHWELLPOSITIV | C–a³
Rohrflöte 8’
Praestant 4’
Blockflöte 4’
Nasard 2 2/3’
Principal 2’
Flageolett 2’
Terz 1 3/5’
Sifflet 1’
Acuta 3f. [1/2’]
Bärpfeife 8’
Glockenspiel
Tremulant
PEDAL | C–g¹
Untersatz 32’
Principal 16’
Subbass 16’
Octave 8’
Spielflöte 8’
Quinte 5 1/3’
Superoctave 4’
Trichterflöte 4’
Rohrgedackt 2’
Hintersatz 5f. [4’]
Posaune 16’
Holztrompete 8’
Schalmey 4’
Koppel I–P
Koppel II–P
Koppel III–P
Koppel IV–P
Setzeranlage [2020] mit 1000 Ebenen zu je 10.000 Speicherplätzen; Crescendowalze.
Schleiflade mit mechanischer Spieltraktur und elektrischer Registertraktur.
D-65549 Limburg a. d. Lahn | Domplatz
Quellen und Literatur: Hermann J. Busch, Die Orgeln des Limburger Doms, Limburg 1978 ⋄ Franz Bösken, Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins, Bd. 2: Das
Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Wiesbaden, Teil 2, Mainz 1975, S. 552–588 ⋄ Eigener Befund.
Nr. 125 | Diese Orgel habe ich am 07.07.2001 im Rahmen einer Konzertprobe gespielt.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 01.02.2025.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25