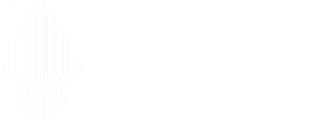- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- Hackenberg (St. Matthias)
- Hackenberg (ev. Gemeindezentrum)
- Häg (St. Michael)
- Haiger (Maria Himmelfahrt)
- Halver (Christus König)
- Hamm (Liebfrauenkirche)
- Hamm/Sieg (ev. Kirche)
- Handorf-Langenberg (St. Barbara)
- Harkebrügge (St. Marien)
- Harsewinkel (St. Paulus)
- Hasselt (Heilig Hart)
- Hasselt (Virga Jesse)
- Hattingen (St. Georg)
- Hatzfeld (Emmauskapelle)
- Heiligengeist bei Villach
- Heinsberg (St. Katharina)
- Helden (St. Hippolytus)
- Hennethal (ev. Kirche)
- Hermagor (St. Hermagoras)
- Herzhausen (St. Anna)
- Hiesfeld (Hl. Geist)
- Hilchenbach (St. Vitus)
- Hilgen-Neuenhaus (Stephanus-Kirche)
- Hilvarenbeek (St. Petrus' Banden)
- Hooksiel (St. Ansgar)
- Horden (ehem. Indep. Methodist Chapel)
- Horst (St. Hippolytus)
- Hude (St. Marien)
- Hüls (St. Cyriakus)
- Hünfeld (St. Bonifatius)
- Hunteburg (Hl. Dreifaltigkeit)
- Hürth (St. Joseph)
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Halver
Kath. Christus König
Orgel: Gebr. Oberlinger (Windesheim), 1981.

Die katholische Kirchengemeinde in Halver (nach der Reformation) besteht seit 1880; zunächst feierten die Katholiken ihre Gottesdienst in einem Missions-Bethaus an der Hagener Straße. Die heutige Christus-König-Kirche nach den Plänen des Paderborner Architekten Max Sonnen wurde am 14. Dezember 1930 geweiht.
Die erste Orgel in der Kirche wurde im September 1936 eingeweiht – der Name des Erbauers und weitere Details über dieses Instrument sind nicht bekannt.
Im Anschluss an die umfassende Kirchenumgestaltung 1976 sollte die Kirche auch eine neue Orgel erhalten. Das Instrument der Orgelbauwerkstätte der Gebr. Oberlinger in Windesheim wurde am 22. März 1981 eingeweiht. Die von Wolfgang Oberlinger entworfene, 23 Register umfassende Disposition fußt auf Dispositionsprinzipien der mittelrheinisch-französischen Tradition der Orgelbauerfamilie Stumm, erweitert diese jedoch: Bemerkenswert ist die vollständige Flötenpyramide auf 16'-Basis im Hauptwerk, während die Disposition des Schwellwerks noch im neobarocken Sinne relativ steil ist. Die Trakturen sind komplett mechanisch gebaut, allerdings greift eine elektrische Setzeranlage in die mechanische Registertraktur ein. Hinter den neun Pfeifenfeldern des Prospekts befindet sich das Hauptwerk. Dahinter ist im oberen Bereich das mit Plexiglasjalousien versehene Schwellwerk zu erkennen. Das Pedalwerk steht in einem eigenen Gehäuse hinter der Orgel.
Die Spielanlage ist frontal in das Orgelgehäuse eingebaut. Darin befinden sich die Registerzüge für Hauptwerk und Pedal auf der linken Seite, die Schwellwerksregister sind an der rechten Seite angeordnet. Die Koppeln können wahlweise über die korerpsondierenden Züge über dem zweiten Manual oder über Fußtritte bedient werden.
Im Herbst 2010 wurde das Instrument durch Orgelbau Fleiter (Münster) gründlich überholt und neu intoniert. Eine weitere grundlegende Sanierung erfolgte 2024 durch die Fa. Romanus Seifert & Sohn (Kevelaer); dabei erhielt die Orgel u. a. eine neue moderne Setzeranlage sowie einen MIDI-Anschluss, und klangliche sowie technische Schwächen wurden behoben.
I. HAUPTWERK | C–g³
Hohlpfeife 16'
Principal 8'
Rohrflöte 8'
Octave 4'
Gedacktflöte 4'
Nasard 2 2/3'
Schwiegel 2'
Mixtur 5fach
Trompete 8'
I-II [richtig: II-I]
II. SCHWELLWERK | C–g³
Copula 8'
Spitzgambe 8' [C–H mit Cop.]
Koppelflöte 4'
Principal 2'
Sifflöte 1'
Sesquialter 2fach
Cymbel 4fach
Hautbois 8'
Tremulant
Cymbelstern
Glockenspiel [nicht eingebaut]
PEDAL | C–f¹
Subbass 16'
Octavbass 8'
Pommer 8'
Dolcan 4'
Mixtur 4fach
Posaune 16'
I-Ped.
II-Ped.
Moderne elektronische Setzeranlage, MIDI-Anschluss, Digitalanzeige.
[Bis 2024: 5 Setzerkombinationen (A bis E) mit Setzknopf (S) und Nulltaster (0)].
Mechanische Schleiflade mit Doppelregistratur für die elektrische Setzeranlage.
D-58553 Halver, Hermann-Köhler-Straße 15
Quellen und Literatur: Gustav K. Ommer, Neue Orgeln im Ruhrgebiet, Duisburg 1984, S. 182 ⋄ Eigener Befund.
Nr. 430 | Diese Orgel habe ich zum ersten Mal am 15.10.2011 und danach mehrfach bei Konzerten und anderen Gelegenheiten gespielt, außerdem 2022 umfassend untersucht.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 01.04.2025.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25